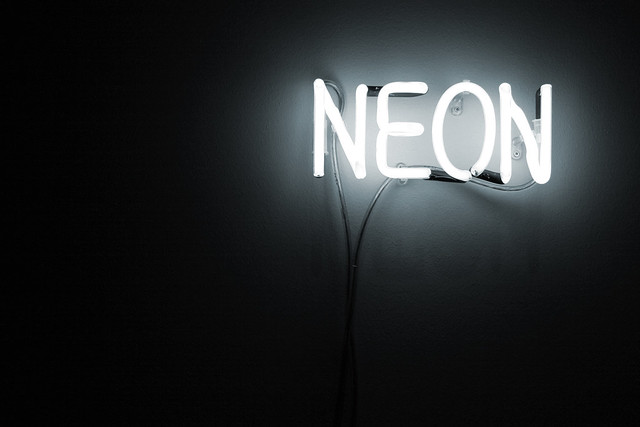Als ich meine Augen öffne, ist der eindeutig beschissenste Tag für Menschen wie uns, die gerade ihre schlimmste Zeit durchmachen müssen. Allerheiligen, wenige Tage, nachdem ein eineinhalb Jahre altes Kind die Augen für immer schließen musste, das passt ganz einfach nicht ins Konzept. Ein normaler Tag am Friedhof würde es wohl nicht werden.
Wir, meine Familie, wie so wohl nur in diesen wenigen kommenden Wochen bestehen würde, haben beschlossen, wieder einmal in die Leichenhalle zu sehen. Der Sarg wurde geschlossen, gestern, von meiner Schwester. Nachdem wir ihn alle noch einmal sehen konnten, ich ein letztes Mal seine Spieluhr aufzog und ihm einen Kuss auf den eiskalten, puppenartigen Kopf gab. Wir würden an keinem Grab stehen sondern unser Entsetzen in kleiner Gruppe teilen. Abschied nehmen in einer ungeahnten Härte. Der Schmerz. Dieser nicht enden wollende Schmerz. Das Vermissen.(1)
Meine Mutter, die immer und immer wieder die kleinen Hosen und Shirts von Timi zusammenlegt. Immer und immer wieder, sie wieder auseinander reißt, und es noch einmal versucht und weint. Das Wetter passt zu unserem Leben, der Nebel setzt sich für lange Zeit fest, eisige Kälte, ein unaufhaltbarer Wind zieht vorbei und ich möchte mich fallen lassen, möchte mich vom Wind davon tragen lassen, möchte einfach nicht da sein. Dieser Schmerz lässt mich taub werden, und ich vergesse schon wieder auf mich selbst.
Jetzt ist wohl auch keine Zeit dafür, etwas auf sich zu achten. Ich werde gebraucht und auch wenn die Last wohl kaum vorstellbar ist, versuche ich sie gut zu meistern. Während meine Eltern und meine Schwester, meine Oma und irgendwie mein gesamtes Umfeld in eine Art Koma verfallen ist, treibe ich mich selbst immer wieder an. Lasse es nicht geschehen, dass etwas ungeschehen bleibt. Das bin ich nicht gewohnt von mir, und es war wohl auch noch nie, dass ich so sehr gebraucht wurde.
Immer und immer wieder lese ich mir meinen Text durch, den ich geschrieben habe. Diesen einen Text, den ich in zwei Tagen am Begräbnis vorlesen würde. Mein Herz pocht, in Gedanken an diesen Moment. Und ich zittere wieder. Zum weinen ist keine Zeit mehr und dann tippe ich auch noch die Fürbitten in den Computer. Wie würde es wohl sein, einem Menschen, dem wohl wichtigsten Menschen meines bisherigen Lebens, diese zwei A4-Seiten zu widmen, nur mit ihm zu reden und ihm vor versammelter Menschenmasse, die nun trauern oder nur Mitleid zeigen wollen, mein Herz ausschütte. Ich weiß es nicht, und ich kann es mir auch nicht einmal ausmalen, wie es denn wirklich werden würde.
Nachdem die Pseudofriedhofsbesucher abgezogen sind, irgendwann Richtung Abend, sind wir schon wieder dort. Beinahe fühle ich mich hier schon zuhause, wenn da nur nicht diese Leichenhalle, dieser Kindersarg und darin verschlossen ein lebloser Körper wäre. Wenn das alles nicht meine Familie betreffen würde, wenn das alles hier nicht unsere Welt wäre. Kerzen brennen, rund um den Sarg liegen Spielsachen verteilt, seine Spielsachen, mit denen er noch vor Tagen gespielt hat.
Irgendwann einmal bricht ein älterer Mann in die Idylle, in das gemeinsame Trauern, in diese unbequeme Leichenhalle, als er einen Blick hineinwirft, und lauthals sich darüber freut, dass er jetzt endlich wisse, von wem dieses Kind sei. Wir, einige von uns, haben ihn nach draußen gedrängt, haben die Tür geschlossen, und am Liebsten hätte ich ihm noch gerne eine verpasst. Er hat die Stille durchbrochen, hat keinen Anstand. Mein Herz pocht bis zum Anschlag, Wut steigt auf und ich bin froh, dass er das Weite sucht. Dieses Arschloch hat es kaputt gemacht, dieser Vollidiot ist in ein „Wir“ gestürmt, das zurzeit eben nichts anderes verträgt.
Zuhause ist es still. Bei uns ist es üblicherweise selten still, aber seit Tagen passiert alles nur gedämpft. Auch die Übertragung der Schallwellen. Es ist das Atmen, das ich manchmal vernehme, das Schluchzen, wenige Worte. Aber keine Worte würden all dem, was jetzt gerade passiert, gerecht werden. Wir schweigen uns an, obwohl wir uns doch unterhalten, wir umarmen, wir rauchen, wir blicken mit feuchten Augen in die Ferne, den Wald, der hie und da durch den Nebel blitzt, verbringen die meiste Zeit am Balkon, wohl um eins mit der Kälte zu werden. Obwohl wir das schon sind.
Und wenn wir alleine sind, meine Eltern und ich, machen wir uns Gedanken um meine Schwester. Unterhalten uns, wie wir ihr jetzt helfen könnten und wie wir es in Zukunft tun können. Es entsteht der Entschluss in mir, meine ehemalige Psychologielehrerin anzuschreiben. Keine Ahnung, warum ich gleich an sie gedacht habe, aber ihr muss ich schreiben. Muss ihr erzählen, was uns passiert ist, muss sie fragen, ob meine Schwester zu ihr kommen könne. Sie würde schließlich nicht hingehen, dafür aber jemand anderer.
Auf all den vier Fensterbänken in meinem Zimmer habe ich Teelichter platziert. Ich weiß nicht mehr warum, vielleicht im Glauben, dass Timi es irgendwo sehen wird. Dass er weiß, dass wir ihn vermissen, und dass er hier ein verdammt großes Loch hinterlassen musste. Immer wenn ich zu Bett gehe, zünde ich sie an, lege mich unter den Tuchent, krümme mich zusammen, kralle mir meine Fingernägel in meine Schulter, denke nach. Immer nur nachdenken. Bis selbst das weh tut. (2) Und irgendwann wird es schließlich Mitternacht. Und irgendwann schlafe ich schließlich ein.
Mehr Kapitel der Geschichte “Walk Away“
(1) Ein letztes Mal., 01.11.2007
(2) Etwas Ablenkung., 02.11.2007
Tweet von gestern Nacht